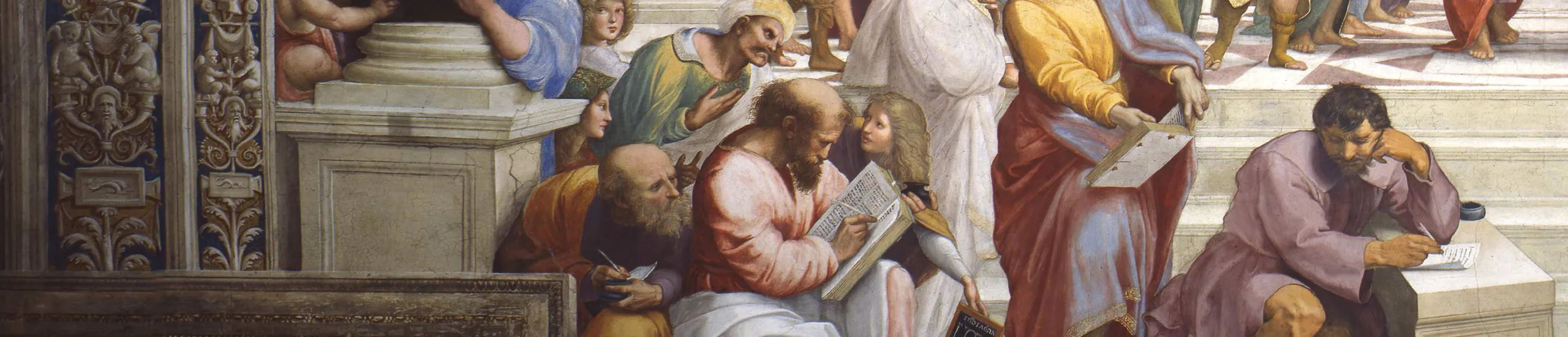Veröffentlichungen
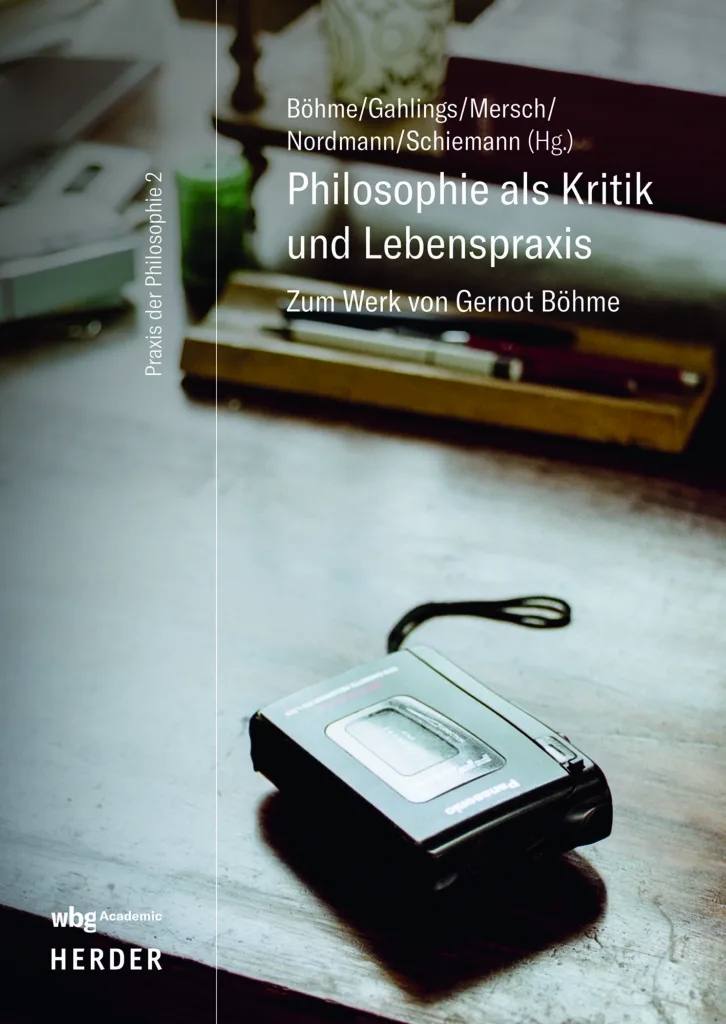
Philosophie als Kritik und Lebenspraxis. Zum Werk von Gernot Böhme
Der Band untersucht das umfangreiche Werk Gernot Böhmes (1937–2022) auf seine Aktualität hin. Im Vordergrund stehen Böhmes Wissenschafts- und Technikkritik, seine Ästhetik und Ökologie sowie seine Phänomenologie der Leiblichkeit und Lebenspraxis. Der gemeinsame Nenner dieser Schwerpunkte ist in den letzten Jahrzehnten immer deutlicher hervorgetreten: die kritische Frage nach Orientierung, Lebensmöglichkeit und Lebensführung in einer durch Krisen bestimmten technisierten Lebenswelt.
Mit Beiträgen von Gernot Böhme, Hartmut Böhme, Rebecca Böhme, Kai Buchholz, Thomas Fuchs, Ute Gahlings, Jürgen Hasse, Martina Heßler, Yuho Hisayama, Wolfgang Krohn, Hilge Landweer, Wolfgang Liebert, Ziad Mahayni, Dieter Mersch, Kira Meyer, Alfred Nordmann, Christoph Rehmann-Sutter, Gregor Schiemann, Jan Cornelius Schmidt, Jens Soentgen, Philipp Thomas und Zhuofei Wang.
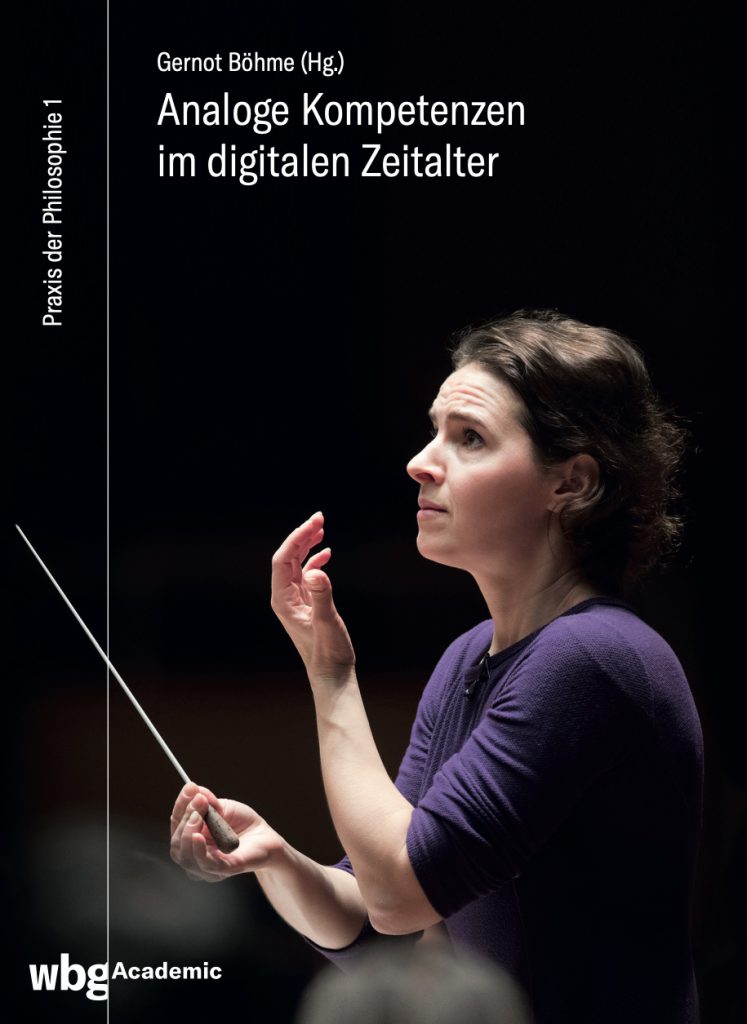
Analoge Kompetenzen im digitalen Zeitalter
Scheinbar kommt das digitale Zeitalter wie eine Naturentwicklung über uns. Doch es gibt keinen Zweifel daran, dass es von politisch-wirtschaftlichen Kräften vorangetrieben wird. Die Corona-Krise hat der Digitalisierung sogar einen immensen zusätzlichen Schub ermöglicht: Digitale Medien dienen jetzt flächendeckend als Substitute für analoge Verhaltensweisen – von der Schule über das soziale Leben und den Kulturkonsum bis zum E-Commerce. Der öffentliche Diskurs über das Für und Wider dieser Entwicklung und die dazu eingerichteten Ethik-Kommissionen fordern allerdings nur, dass die Digitalisierung der Gesellschaft ›human‹ gestaltet werden soll. Im Dunkeln bleibt dabei, was im Rücken der fortschreitenden digitalen Vernetzung aller Lebensbereiche geschieht. Deshalb fragt dieser Band nach den analogen Kompetenzen. Unsere These: Die analogen Kompetenzen veröden, werden verlernt oder – in der heranwachsenden Generation – gar nicht erst erworben.
Mit Beiträgen von Gernot Böhme, Rebecca Böhme, Kai Buchholz, Ute Gahlings, Wolfgang Reinert und Justus Theinert.
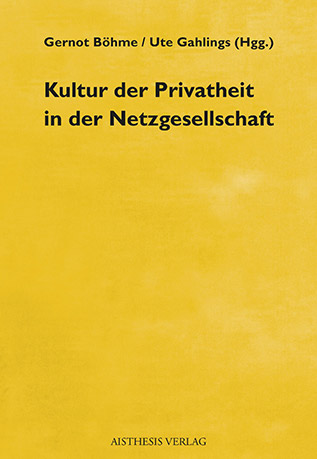
Kultur der Privatheit in der Netzgesellschaft
Während die öffentliche Diskussion sich durchweg mit dem Schutz der Privatheit in technischer, juristischer und politischer Hinsicht beschäftigt, fragten wir uns nach dem Inhalt der Privatheit. Könnte es sein, dass das, was wir da schützen wollen, bereits weitgehend erodiert ist? Was kann der einzelne Mensch – mit anderen zusammen – in dieser Situation tun, um Privatheit überhaupt erst zu entwickeln? Durch welche Umgangsformen wird die Familie zu einem Bereich geteilter Privatheit? Wie geht man miteinander um, damit leibliche Intimität etwas Privates ist? Wie richtet man die eigene Wohnung ein, damit sie nicht nur ein grundgesetzlich geschützter Raum ist, sondern durch Einrichtung und individuellen Ausdruck den Charakter des Privaten hat? Daran schließen sich Fragen nach dem persönlichen Gespräch, dem persönlichen Brief, dem Tagebuch an.
Mit Beiträgen von Gernot Böhme, Kai Buchholz, Marianne Brieskorn-Zinke, Ute Gahlings, Andreas Gohlke, Kai W. Müller, Wolfgang Reinert, Beate Rössler und Kai Erik Trost.
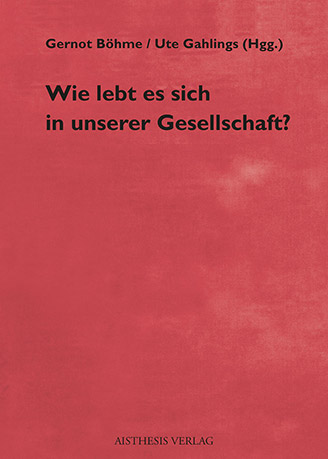
Wie lebt es sich in unserer Gesellschaft?
Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft mit einem umfassenden sozialen Netz, die Bundesrepublik ist ein Rechtsstaat mit einer gut funktionierenden Demokratie, und auf ihrem Territorium sind nach 1945 keine Konflikte mehr mit Waffengewalt ausgetragen worden. Und doch, wer ist schon glücklich in diesem Land? Nicht nur, dass der Wohlstand durch rigide Organisation des Lebens und Stress erkauft wird, dass kein Gefühl der Sicherheit, der Zufriedenheit aufkommen mag – Ressentiments verdichten sich immer wieder zu Wellen des Unbehagens, zu Bewegungen, die aber auch nicht erkennen lassen, wo die Zukunft unserer Gesellschaft liegen sollte. Woran liegt das? Das vorliegende Buch geht die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche durch, um die Gründe für dieses Unbehagen im Wohlstand aus der Perspektive der einzelnen Bürgerin, des einzelnen Bürgers zu benennen.
Mit Beiträgen von Gernot Böhme, Kai Buchholz, Marianne Brieskorn-Zinke, Klaus Dörre, Ute Gahlings, Klaus von Lampe, Ziad Mahayni, Rudi Schmiede und Nico Stehr
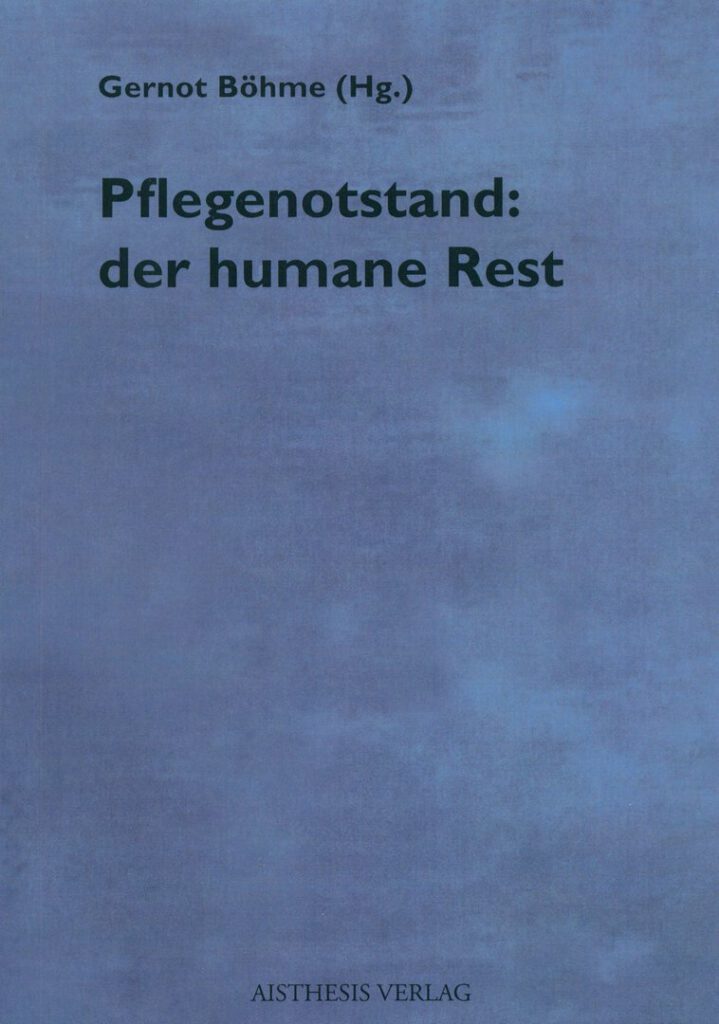
Pflegenotstand: Der humane Rest
Der in unserem Gesundheitssystem zu beklagende Pflegenotstand wird in der öffentlichen Diskussion zumeist als Fachkräftemangel wahrgenommen. Doch sollte in diesem Zusammenhang betont werden, dass die Pflege unter dem Druck von Kostendämpfung, Rationalisierung und Professionalisierung menschlich ärmer wird. Wie auch immer politisch dem Pflegenotstand begegnet wird, zu konstatieren bleibt stets ein humaner Rest. Die Grundthese dieses Buches besagt, dass das eigentliche Problem des Pflegenotstands im Mangel an menschlicher Zuwendung besteht.
Mit Beiträgen von Gernot Böhme, Marianne Brieskorn-Zinke, Klaus Dörner, Ute Gahlings, Thomas Gerlinger, Gabriele Kleiner, Sabine Köhler, Petra Rogge und Sabine Weidert
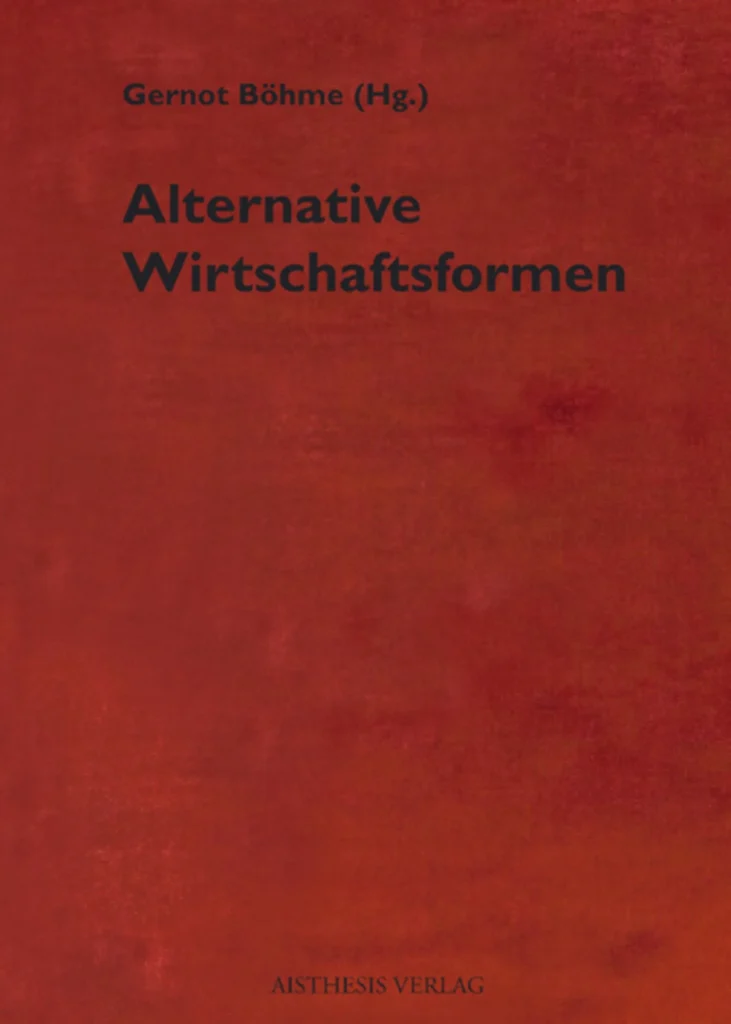
Alternative Wirtschaftsformen
Das Unbehagen an den gegenwärtigen Verhältnissen, an der Leistungsgesellschaft, am kapitalistischen Wirtschaftssystem, wird erst zur bestimmten Kritik, wenn man alternative Wirtschaftsformen ins Auge fasst. In diesem Buch werden Alternativen mittlerer Reichweite vorgestellt: gemeinwohlorientiertes und genossenschaftliches Wirtschaften, solidarische Ökonomie, Nachbarschaftswirtschaft, die Einführung eines Regionalgeldes – und schließlich auch die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens.
Mit Beiträgen von Elmar Altvater, Gernot Böhme, Kai Buchholz, Klaus Dörner, Ute Gahlings, Margrit Kennedy, Rolf Merten, Andreas Neukirch, Werner Peters, Sibylle Riffel, Bernd Villhauer und Götz Werner.
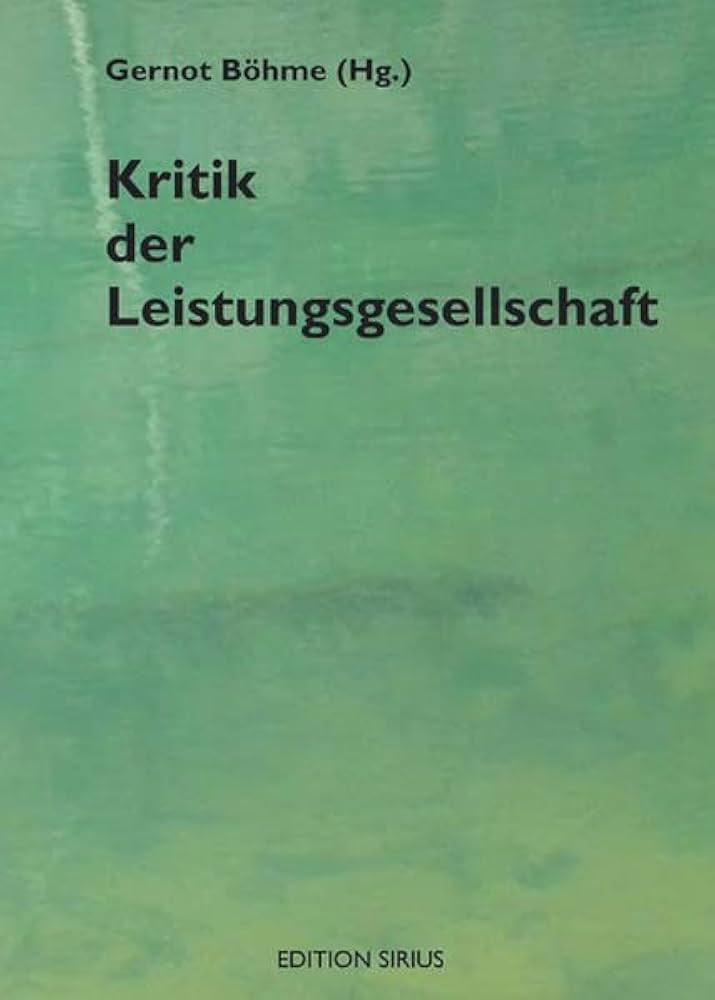
Kritik der Leistungsgesellschaft
Wir leben in Deutschland in einer Gesellschaft mit hervorragenden Einrichtungen – Demokratie, soziale Markwirtschaft, soziales Netz, Bildungssystem, Gesundheitssystem – einer Gesellschaft, die gleichwohl den Menschen kein Gefühl der Zufriedenheit vermittelt. Im Gegenteil sind alle Bürger im Stress und in einem Denken befangen, das ihnen auf allen Gebieten immer mehr Leistung abverlangt – und zwar nicht nur im Bereich der Arbeit, sondern auch in Konsum und Freizeit. Für das einzelne Mitglied der Gesellschaft ist dieser Zustand zu bedauern, verglichen mit der Lage anderer Nationen und angesichts des herrschenden Elends in der Welt, ist er beschämend. Der Analyse dieser widersprüchlichen Situation widmen sich die Beiträge dieses Bandes.
Mit Beiträgen von Gernot Böhme, Gisela Dischner-Vogel, Ute Gahlings, Ines Geipel, Ziad Mahayni, Richard Münch, Helga Peskoller, Sibylle Riffel und Volker Schubert.
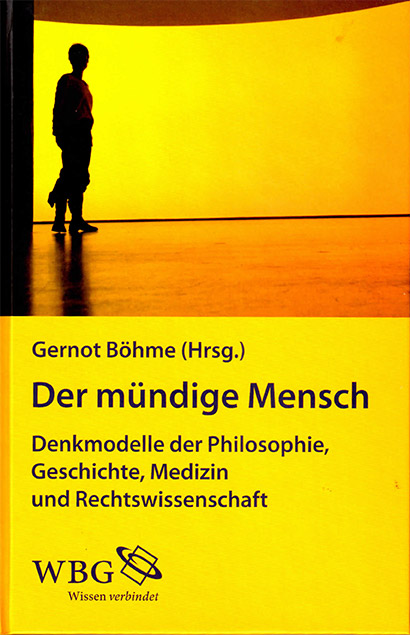
Der mündige Mensch
Mündigkeit ist für demokratische, offene Gesellschaften ein entscheidender Begriff. Mündig soll der Bürger sein, um über alle Fragen frei und souverän diskutieren zu können. Aber ist er das immer? Und welche Rolle spielt die Mündigkeit außerhalb des politischen Raums? In der Ehe? Bei medizinischen Fragen? Bei wirtschaftlichen Problemen, z.B. Kaufentscheidungen? All dies wird hier interdisziplinär verhandelt, wobei sich die philosophische Konzeption der Mündigkeit wie ein roter Faden durch die Beiträge zieht.
Mit Beiträgen von Farideh Akashe-Böhme, Kai Buchholz, Gernot Böhme, Ute Gahlings, Andreas Gruschka, Thomas Hillenkamp, Wolf-Dieter Narr, Stefan Ruppert, Bernd Villhauer und Uwe Volkmann.
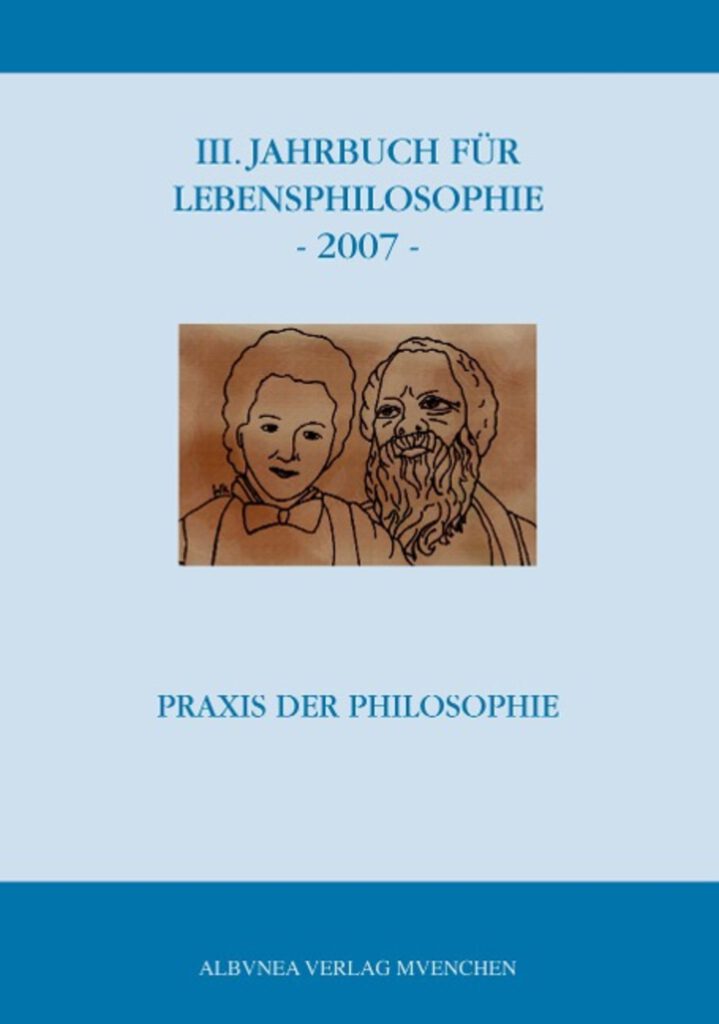
Praxis der Philosophie
Gegenstand dieses Buches – zugleich Festschrift zum 70. Geburtstag von Gernot Böhme – ist die Praxis der Philosophie: ein eng mit Böhme und seinem Institut für Praxis der Philosophie verbundenes Thema. Praxis der Philosophie meint ein Philosophieren, das praktisch wird; vielleicht auch ein Philosophieren, das immer schon praktisch war, weil es sich nie nur als Theorie um der Theorie willen verstanden hat. Praktisch wird Philosophie, wenn sie gelebt wird, wenn sie also zu einer spezifisch philosophischen Lebensweise führt: Philosophie als Lebensform. Praktisch wird Philosophie aber auch, wenn sie zu gesellschaftlichem Engagement und zivilisationskritischem Handeln führt: Philosophie als Weltweisheit und utopische Praxis.
Mit Beiträgen von Hartmut Böhme, Kai Buchholz, Doris Croome, Ute Gahlings, Christoph Helferich, Fabian Heubel, Robert Josef Kozljanič, Anders Lindseth, Elisabeth List, Tadashi Ogawa, Guido Rappe, Hermann Schmitz, Richard Shusterman und Philipp Thomas.